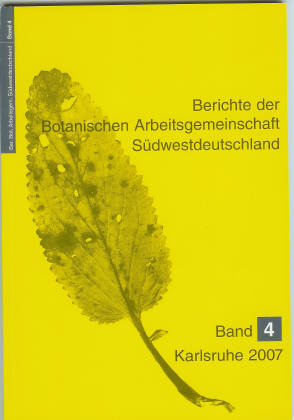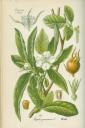Ludemann Thomas, Röske Wolfgan & Krug Matthias 2007: Atlas zur Vegetation des Südschwarzwaldes – Feldberg, Belchen, Oberes Wiesental. – Mitt. Ver. Forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 45: 1-100; Freiburg. ISSN 0506-7049. Bezug: VFS-Geschäftsstelle, Wonnhaldestraße 3a, 79100 Freiburg. Preis 19,00 €.
Besprechung von SIEGFRIED DEMUTH, Karlsruhe
Das Feldberggebiet im Südschwarzwald gehört zu den botanisch interessantes und wertvollsten Gebieten Baden-Württembergs. Daher ist es erfreulich, dass nach 25 Jahren durch den Verein für forstliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung wieder eine Vegetationskarte veröffentlicht wurde. Die erste vegetationskundliche Karte von Erich Oberdorfer erschien 1982 und umfasste die Topografische Karte TK 8114 – Feldberg und damit eine Fläche von etwa 137 km² (Oberdorfer E. 1982: Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte Feldberg (1:25000). – Beih. Veröffentl. Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemg 27: 5-83. Karlsruhe). Er unterschied 31 Vegetationstypen, darunter 18 Waldtypen. Die aktuell vorliegende Kartierung von T. Ludemann, W. Röske und M. Krug gibt die Vegetation nicht einer Topografische Karte wieder, sondern von vier Naturschutzgebieten (NSG), zwei geplanten Erweiterungsflächen und zwei geplanten NSG. Diese Gebiete verteilen sich auf die TK 8112, 8113, 8114, 8212, 8213 und 8214 (leider gibt es in der Arbeit keine Übersichtskarte mit dem Blattschnitt der Topographischen Karten). Nach einer kurzen Einführung zu Geologie, Klima, Boden, Besitzverhältnissen sowie land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in ihrer heutigen und ihrer früheren Form, wird ausführlich die Kartierungsmethode erläutert. Grundlagen sind zum einen etwa 500 Vegetationsaufnahmen von Waldbeständen aus den Jahren 1987–1989, die Biotoptypen nach dem Biotoptypenschlüssel von Baden-Württemberg