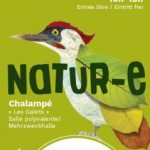von Martin Engelhardt
Die diesjährige Jahresexkursion führte auf die südlich von Balingen gelegenen Berge des Schwäbischen Alb. Am Sonntag, den 30. Juni – einem ausgesprochen heißen Tag – trafen sich die 13 hartgesottenen Teilnehmer um 10.00 Uhr am Parkplatz auf der Passhöhe am Lochen zwischen Weilstetten und Tieringen (TK 7719/3).
Die Exkursion, unter Leitung von Martin Engelhardt aus Tübingen, führt vom Parkplatz zuerst zur „Lochenkanzel“, einem gewaltigen Malmfelsen (Malm ?-Lochenfazies), der wohl 30 m senkrecht in die Tiefe stürzt. Bereits auf dem Weg dorthin wurden die ersten floristischen Besonderheiten entdeckt, so die Crassulacee Jovibarba globulifera. Der Fund gab Anlass für rege Diskussion: Ist das Vorkommen autochton? Nach welchen Kriterien kann man sich bei einer Einschätzung richten? In der Nähe fanden sich auch Saxifraga paniculata, Sedum rupestre, Sedum album, Rosa spinosissima und Melica ciliata. Auf dem Rückweg wurde am Fuß der südlich Felsen auch die Gänsesterbe (Erysimum crepidifolium) in einem fruchtenden Exemplar gefunden. Direkt an der Kante der Hochfläche fand sich ein größerer Bestand von Phleum phleoides. Offenbar ist der Boden an der Felskante hier oberflächlich ein wenig entkalkt. Entlang des Weges fanden sich nebeneinander sowohl die „behaarte“, als auch die “unbehaarte“ Sippe des Feld-Thymians. Je nach Auffassung (ob Unterarten oder Arten) heißen diese Thymus pulegioides subsp. carniolicus / Thymus froelichianus bzw. Thymus pulegioides subsp. pulegioides / Thymus chamaedrys. Unmittelbar neben diesen fand sich Onobrychis montana.
Am Aussichtspunkt der Lochenkanzel (962,9 m NN) konnte die typische Felsvegetation mit Festuca pallens, Sesleria albicans, Carex humilis, Allium lusitanicum, Saxifraga paniculata, Leucanthemum adustum, u.a.m.. beobachtet werden. Hier wurde als Seltenheit auch Athamanta cretensis in einigen Exemplaren gefunden. Diese Sippe kommt in Baden-Württemberg nur auf Schwammfelsen an der Südseite des Eyachtals bei Balingen autochton vor. Ein Vorkommen bei Dettingen an der Erms geht offenbar auf eine Ansalbung um 1930 zurück. In einer Felsspalte am Fuße des Felsens fand sich Taraxacum rubicundum, die auf der Alb am weitesten verbreitete Sippe aus der Gruppe der Rotfrüchtigen Löwenzähne. Die Blattform war typisch „bügelförmig“. Leider war Taraxacum lacistophyllum nicht zu finden, dass eher typisch „pagodenartige“ Blätter besitzt. In der Umgebung des Felsens fand sich auch Seseli libanotis und Pulsatilla vulgaris. Hier war Gelegenheit bei guter Aussicht die geologische Struktur des Albtrauf zu besprechen.
Danach führt die Exkursionsroute vorbei am „Lochengründle“ (klassische Fossillienfundstelle) und dann an der Jugendherberge am Lochenpass vorbei, am Albtrauf entlang durch das Naturschutzgebiet „Hülenbuchwiesen“ zum „Hörnle“. Auf der Balinger Alb kommt – im Gegensatz zu den meist von Rotbuchen (Fagus silvatica) dominierten Traufwäldern (Kalkbuchenwald) der Schwäbischen Alb – hauptsächlich Ahorn-Eschen-Ulmen-Wald vor, mit bemerkenswert alten, über 50 m hohen Weißtannen (Abies alba) und hier wohl einem natürlichem Auftreten der Fichte (Picea excelsa). Hier kommen Arten der Wälder, der Magerwiesen und der Saumvegetation oft kleinräumig nebeneinander vor. Folgende Arten, die beobachtet wurden, seien erwähnt: Amelanchier embergeri, Cotoneaster integerrimus, Ribes alpinum, Sorbus aria s.str., Buphthalmum salicifolium, Filipendula vulgaris, Galium boreale, Genista sagittalis, Gentiana lutea, Laserpitium latifolium, Orchis mascula, Phyteuma orbiculare, Platanthera bifolia agg., Polygonatum verticillatum, Polystichium aculeatum, Thesium bavarum, Trifolium montanum und Trifolium rubens.
Leider sind große Bereich der mageren Bergwiesen offenbar am Tag vor der Exkursion gemäht worden wohingegen einige Bereich im Kernbereich deutlich überständig waren und mitunter riesige Klappertopfbestände trugen. Die Teilnehmer hatten daher Anlass über die Ziele des Naturschutzes, Mähzeitpunkte, die Verwertung des Mähguts und andere Themen ausführlich zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen.
Das „Hörnle“ ist wie die „Lochenkanzel“ eine Malm-Felsnase in 956,4 m u. NN, die hier in spitzem Winkel ins Eyachtal vorspringt. Die wenig gedüngten, großflächigen und einschürig genutzten, artenreichen Holzwiesen, über die der Weg zum „Hörnle“ führt, sind Refugien von Muscari botryoides, Gentiana verna, Centaurea montana und anderen Arten. Leider sind früher hier bzw. an den Lochen vorkommende Arten wie z.B. Anemonastrum narcissiflora, Arnica montana, Coeloglossum viride, Herminium monorchis, Traunsteinera globosa längst durch nicht angepasste Nutzung erloschen.
Am „Hörnle“ wurde im Schatten Mittagspause gemacht und die Gruppe machte sich dann wieder auf den Rückweg zum Parkplatz am Lochenpass, wo die Exkursion pünktlich um 16 Uhr endete.