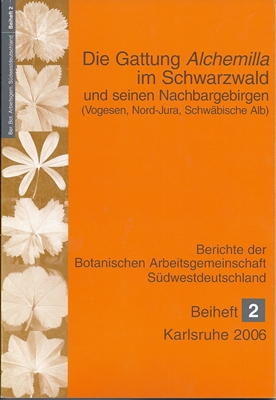GEROLD HÜGIN: Die Gattung Alchemilla im Schwarzwald und seinen Nachbargebirgen (Vogesen, Nord-Jura, Schwäbische Alb)
Zum Download klicken Sie hier [pdf].
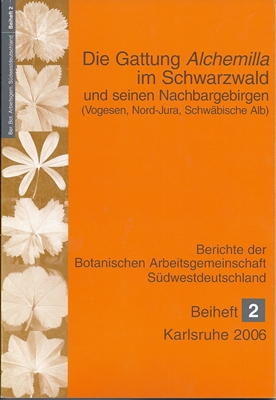
Berichte der botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland Beiheft 2
April 2006
88 S. + Abbildungen
Karlsruhe
ISSN 1860-5273
INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung
2 Die Gattung Alchemilla im Überblick
3 Das Untersuchungsgebiet
4 Die Verbreitung der Alchemilla-Arten im Schwarzwald
5 Die Verbreitung der Alchemilla-Arten in den Nachbargebirgen und im überregionalen Vergleich
5.1 Die Alchemillenflora der Vogesen
5.2 Die Alchemillenflora des Nord-Juras
5.3 Die Alchemillenflora der Schwäbischen Alb
5.4 Die Alchemillenflora des Schwarzwalds im überregionalen Vergleich
6 Kartierungsstand – Kartierungslücken, verwendete Daten
7 Die bevorzugten Alchemilla-Wuchsorte
7.1 Alchemillen als Nährstoffzeiger
7.2 Die bevorzugten Feuchtestufen
7.3 Basiphyten unter den Alchemilla-Arten
8 Die Bindung der Gattung Alchemilla an die Gebirge
8.1 Feuchte Standorte als bevorzugte Alchemilla-Wuchsorte
8.2 Schneemulden als bevorzugte Alchemilla-Wuchsorte
8.3 Kaltluftlagen als bevorzugte Alchemilla-Wuchsorte
9 Alchemilla-Arten als Zeugen der Florengeschichte
9.1 Unterschiede im Artenbestand zwischen Schwarzwald und Vogesen
9.2 Kleinareale im Jura als Hinweis auf Reliktvorkommen?
9.3 Der Artenreichtum des Juras
9.4 Haben auch in Schwarzwald und Vogesen Alchemilla-Arten die letzte Eiszeit überdauert?
10 Die Förderung der Gattung Alchemilla in der Kulturlandschaft
10.1 Alchemilla-Arten als Apophyten
10.2 Alchemilla-Arten als Neophyten
10.3 Wie groß ist der menschliche Einfluss auf Alchemilla-Areale?
11 Worin sind Kleinareale begründet?
11.1 Standortsbedingte Kleinareale
11.2 Kleinareale als Vorposten
11.3 Kleinareale als Reliktvorkommen?
11.4 Neophyten mit Kleinareal
12 Die Gefährdung der Gattung Alchemilla
13 Die Sonderstellung des Schwarzwalds
14 Dank
15 Literatur
Alphabetisches Verzeichnis der Verbreitungskarten
Impressum
Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland
Beiheft 2, März 2006, Karlsruhe
ISSN 1860-5273
Herausgeberin:
Botanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e.V.
Geschäftsstelle: Bahnhofstr. 38, 76137 Karlsruhe, Telefon: 0721/9379386
Internet: http://www.botanik-sw.de, E-Mail: info[at]botanik-sw.de
Bankverbindung: Postbank Karlsruhe (BLZ 660 100 75), Kto. Nr. 607 112-755
Redaktion:
Thomas Breunig und Siegfried Demuth, Bahnhofstr. 38, D-76137 Karlsruhe
Herstellung: medien+werk, 76227 Karlsruhe
© Botanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e.V.