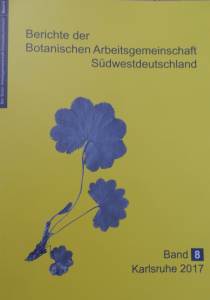von MARKUS SONNBERGER, Heiligkreuzsteinach
Samstag, 27. Juni: Naturraum; Bauland/Sandstein-Odenwald; Baden-Württemberg; Elztal; 6621/1; Neckarburken. „Bürgerwald-Heppenstein“; Magerwiesen, Kalk-Wald; Treffpunkt: 11:00; Bahnhof Neckarburken; N 49,37834° O 9,16321°.
Die erste Exkursion startete aufgrund der Corona-Krise erst spät, nämlich Ende Juni. Und war auch eher ein touristischer Termin. Erfreulich war dementsprechend die mit 10 Personen ganz ordentliche Teilnehmerzahl. Zuerst sollte ein Gebiet begangen werden das – im geologischen Übergangsbereich von Bauland zu Odenwald gelegen – eine besonders hohe Struktur- und Standortsvielfalt aufweist. Vom Neckarburkener Bahnhof ging es nach Nordosten in Richtung des NSG „Landschaft um den Heppenstein“ (östlicher Teil) am „Zimmerplatz“. In der Klinge hinter den Häusern stehen noch Buntsandstein-Klippen an. Mit Überwindung der kleinen Steilstufe erreicht man oberhalb des „Roteberg“ ein schon stark vom Kalkgehalt des Muschelkalkes geprägtes Wiesen- und Ackergelände. Die Aufrechte Trespe (Bromus erectus) dominiert hier die trockeneren Stellen im Grünland, die waldnahen Säume an der Wegböschung sind artenreich, wenn auch nicht gerade hervorragend. Am NSG „Orchideenwiese“ hätten wir nun eine nochmals deutlich bessere Situation erwartet. Leider waren aber selbst die bekanntermaßen an Orchideen reichen Flecken abgemäht, der Fruchtansatz der früher blühenden Arten und natürlich auch die Sommerblüher also vernichtet.
Überhaupt macht das Grünland auch von der Nutzungsintensität her nicht gerade den Eindruck eines Naturreservates. Hinter dem NSG (östlich davon) sind wir dann durch den Wald weiter nach oben gegangen. Über Muschelkalk sind hier artenreiche Laub-Mischwälder entwickelt, durchmischt mit einzelnen Kiefern. Seidelbast (Daphne mezereum), Akelei (Aquilegia vulgaris), Weißes (Cephalanthera damasonium, verblüht) und Rotes Waldvögelein (C. rubra, gerade blühend) waren verbreitet und sind auch typisch für diese Gegend. Auch die charakteristischen Austriebe der Violetten Ständelwurz (Epipactis purpurata) waren schon zu finden. Auf der Hochfläche wendete sich unsere Exkursion Richtung Westen. Der freundliche Revierleiter vom Forstamt, der unsere Exkursion kenntnisreich begleitete, wies uns auf die prächtigen, gerade aufblühenden Türkenbund-Lilien (Lilium martagon) hin. Die Art besitzt im Bauland und Odenwald eine sehr fleckenhafte Verbreitung, kann dann aber lokal in (relativ) größerer Zahl vorkommen, so wie verschiedentlich im unteren Elztal. Im Bereich des „Heppenstein“ kommt man wieder auf eine Hochfläche mit teils wasserstaudem, mergeligem Muschelkalk. Es ist ein klassisches Beobachtungsrevier für Insekten- und Pflanzen-Freunde und war glücklicherweise noch nicht unters Messer gekommen. Das Gebiet steht schon lange unter Naturschutz und wurde 1940 als „Reliktföhrenwald auf dem Heppenstein“ erstmals verordnet. Der alte Name stammt her vom mutmaßlichen Zusammenhang zwischen Funden von Kiefernholzkohle am Neckarburkener Römerlager und den urwüchsig scheinenden Kiefern auf der Muschelkalkhöhe. Tatsächlich könnte die Kiefer an diesen Standorten auch urwüchsig sein und ganz sicher waren hier auch die Römer unterwegs, bietet der Aufstieg über Roteberg und Heppenstein doch den einfachsten, karrenbefahrbaren Zugang auf die Odenwald-Hochfläche, wo hier auch der Odenwald-Limes liegt. Die immer noch prägenden Altwege-Gleise bieten heute ein besonders interessantes Standortsmosaik.
Der aktuelle Kiefernwald auf dem Heppenstein ist überwiegend forstlichen Ursprungs, wie schon die reichliche Anwesenheit der Schwarz-Kiefer verrät. Der Revierleiter wusste zu berichten, dass der Bestand in der ersten Hälfte des 20. Jh. mit der Absicht angelegt wurde, Grubenhölzer für die Bergwerke im „Osten“ bereit zu stellen. Das langsame Wachstum auf dem kargen Boden sollte wohl für ein besonders dichtes Holz sorgen. Insgesamt macht der Standort auch heute noch eher den Eindruck eines dealpinen Schneeheide-Kiefernwaldes, wie man ihn etwa am mittleren und unteren Lech findet. Im Unterwuchs dominieren Pfeifengras (Molinia arundinacea) und Berg-Segge (Carex montana). Auch die Strauchschicht ist artenreich, wobei Liguster und Wacholder zu den dominanteren Arten gehören. Damit die Gehölze nicht wie anderenorts Überhand nehmen, wird hier unter den Kiefern jeweils im Herbst gemäht. Es sei angemerkt, dass die Mahd des Pfeifengrases zur Blüte von Fransen- (Gentianopsis ciliata) und Deutschem Enzian (Gentianella germanica) erfolgt, was offensichtlich zu dramatischen Bestandseinbußen geführt hat.
Zur Zeit unserer Exkursion, zu Beginn des Hochsommers, zeigt sich das Gebiet aber in seiner schönsten Pracht. Zum Teil massenhaft blühen die Orchideen, wie Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea) und Wohlriechende Händelwurz (G. odoratissima), die hier ihr letztes reichlicheres Vorkommen in Nordbaden hat. Die Echte Sumpfwurz (Epipactis palustris) hat indes mit der Trockenheit sehr zu kämpfen – und auch mit dem Andrang der Orchideenliebhaber, die den früher blühenden Arten zum Teil in Scharen ihre Aufwartung machen und die eher unscheinbaren Austriebe der Sumpfwurz platttreten. Eine effektivere Besucherlenkung haben wir vor Ort diskutiert, zumal offensichtlich auch der Wacholder „ein Problem“ hat, wie zahlreiche absterbende Sträucher beweisen. Trockenheit dürfte hier eher nicht als Ursache in Frage kommen, wahrscheinlicher ist, dass auch hier mikrobielle Erreger wie Phytophtora cinnamomi/ austrocedrae angekommen sind. Und die werden bekanntermaßen durch die Füße von Wanderern ausgebreitet.
Der weitere Weg führte dann rasch wieder hinab zum Bahnhof, wo sich ein Teil der Teilnehmer auf den Rückweg machte, während die anderen einen zweiten Rundgang anvisierten. Auf dem Bahnsteig fiel einem unserer Teilnehmer (PBK) schließlich noch ein kleines Pflänzchen auf, das wir hier nicht vermutet hätten, nämlich das seltene Behaarte Bruchkraut (Herniaria hirsuta). Die Art tritt bedeutend seltener auf als das mittlerweile recht häufige Kahle Bruchkraut (H. glabra) und wurde in der Umgebung z. B. in Pflasterfugen des Mosbacher Marktplatzes gefunden. Aus floristischer Sicht war das kleine, kronblattlose Nelkengewächs jedenfalls der Fund des Tages.
Samstag, 1. August: Naturraum; Bauland; Baden-Württemberg; Adelsheim; 6622; 1; Adelsheim, „Wirsching-Burgstall-Au“; Laub-Mischwald, Kleebwald, Grünland; Treffpunkt: 11:00; Adelsheim, Rohnstockweg, Seckachtal-Stadion; N 49,39899° O 9,39142°. Rosenberg; 6523; 1; Hirschlanden, „Ortslage-Reissig“; Ortslage, Grünland, Äcker, Laubwald; schlechter Kartierstand (12 Arten); Treffpunkt: 16:00; Hirschlanden, Sportplatz; N 49,47095° O 9,50140°.
Die nächste Exkursion führte gleich wieder ins Bauland, das überhaupt noch einige weiße Flecken bezüglich Kartierdichte aufweist. Die Mittagstour hatte das Seckachtal südlich von Adelsheim zum Ziel. Die Region wurde von Meszmer (1998: Flora des Neckar-Odenwald-Kreises. Laub, Dallau) in der Vergangenheit gut untersucht. Neuere Beobachtungen liegen aber kaum vor. Insgesamt war auch hier die extreme Trockenheit ein großes Problem, dennoch war noch nicht alles verdorrt. Der Weg führte zunächst am Osthang unterhalb des „Rohnstock“ durch Laub-Mischwald, der noch einige Charakterarten landschaftstypischer Edellaubholz-Mischwälder aufwies, überwiegend aber durch fortstliche Maßnahmen und rücksichtslose Holzwerbung ruderalisiert war. Am Wegrand fand sich eine größere Kolonie der Moschus-Erdbeere (Fragaria moschata) wie sie einem im mittleren Bauland immer wieder begegnen. Vielleicht ist diese Art hier tatsächlich heimisch. Nördlich vom „Wirsching“ liegen am Südhang über der Seckachaue schöne Offenland-Bereiche mit Streuobst, Trockenmauern und Halbtrockenrasen. Schwertlilien (Iris sect. Iris) waren zu finden, und im Frühjahr gibt´s da sicher auch noch mehr schöne Sachen. Bei der Trockenheit ist die Fläche aber leider wieder nur ein Posten mehr auf der „Da-müsste-man-noch-mal-hin-Liste“.
Weiter ging´s Richtung „Burgstall“, ein nach Nordost exponierter, eher feuchter Hang. Hier war Wolliger Hahnenfuß (Ranunculus lanuginosus) zu finden und auch – zunächst unterhalb des Weges – eine Kolonie Spitzwegerich-ähnlicher Grasblätter: die Wimper-Segge (Carex pilosa), die hier bisher gar nicht, auch nicht in der Umgebung des Baulandes gefunden wurde. Der nächstgelegene Fundort liegt, gleichermaßen isoliert, sieben Messtischblätter weiter südwestlich am Nordrand des Schwarzwaldes. Nun neigen Seggen nicht gerade zur Bildung adventiver Ansiedelungen, vielmehr sind weiträumig isolierte Kolonien am Arealrand bei vielen Arten bekannt. An der talseitigen Wegböschung ist ein Vorkommen aber allemal verdächtig. Viele Waldwege kann man schließlich als Kleindeponien auffassen. Wenig weiter setzt sich die Kolonie aber auch oberhalb der Wegböschung in augenscheinlich wenig beeinträchtigtem Kleebwald fort. Da muss man also wirklich noch mal hin! Zurück ging es dann durch die Aue, wo Meszmer (loc. cit.) noch eine große Kolonie des Breitblättrigen Knabenkrauts fand. Völlig ausschließen möchte man die Persistenz des Vorkommens anhand der vorgefundenen Indizien nicht. Carex acutiformis und C. disticha weisen auf einen Feuchtwiesen-Standort hin. Damit hätte man schon drei Gründe, noch mal hinzugehen. Die Nachmittagsexkursion zog uns in ein anders „Weißes Loch“ ca. 10 km weiter nordöstlich, nämlich ins schöne Örtchen Hirschlanden im Quadrant 6523/1 mit seinen bisher stattlichen 12 bekannten Arten. Da sollten wir doch zumindest noch eine Null daran bekommen – so war´s dann auch (233 Arten). Allerdings ist auch hier eher hängegeblieben, dass die Ecke ganz unterschätzt ist und ein Frühjahrs-Besuch, abseits einer Rekorddürre sicher noch viel ergiebiger gewesen wäre. Grundlage dafür sind in erster Linie die schönen Streuobstwiesen v. a. im Süden des Ortes. Die Obstbäume stehen, zumindest soweit wir das gesehen haben, in artenreichen Kalk-Magerwiesen voller Rosetten vielversprechender Magerkeitszeiger, wie Cirsium acaulon, Carex flacca und Trifolium medium. Auch die Säume am Waldrand sind interessant.
Sonntag, 20. September: Naturraum; Nördliche Oberrheinebene; Baden-Württemberg; Mannheim; 6516/22; Mannheim, „Innenstadt“, SW; Innenstadtkartierung, Ruderalvegetation; Treffpunkt: 10:00; Paradeplatz; N 49,48708° O 8,46638°.
Die Mannheim-Innenstadt-Exkursion gehört seit Jahren zum festen Programm der Regionalgruppe Kurpfalz. Sie findet immer am dritten Sonntag im September statt und führt in jährlich im Uhrzeigersinn wechselnde „Quadranten“ der praktischerweise ihrerseits nach Quadraten gegliederten Innenstadt. Die Grenzen unserer (nicht ganz gleich zugeschnittenen) Quadranten sind dabei in NW-SO-Richtung die „Planken“ und in SW-NO-Richtung die „Kurpfalzstraße“. Ziel ist letztlich der langjährige Vergleich der qualitativen Florentwicklung an solchen ultraurbanen Lebensräumen. 2020 war der SW-Quadrant Ziel der Exkursion. Methodik ist auch hier die eines „Random Meander“ von Baumscheibe zu Blumenkübel, von Park zu Parkplatz. Und auch in den Pflasterfugen, am Gebäudesockel und den schmalen Rasenstreifen vor den Wohnblöcken findet sich etwas Spontanvegetation. Situationstypische Nitratimmissionen und hohe Störungsfrequenz moderieren das Artenspektrum. Die besondere Wärmegunst tut ihr Übriges, so dass viele, oft auch sonst seltene Sommerannuelle, zu finden sind.
Die Familien der Fuchsschwanzgewächse und der Nachtschattengewächse sind besonders prominent vertreten. So bildet z.B. der Sarracha-Nachtschatten (Solanum sarrachoides) im Umfeld des Schlosses große Bestände. In der Nähe der alten Sternwarte fanden wir nach Jahren auch wieder ein kräftiges Einzelexemplar des Schneeballblättrigen Gänsefuß (Chenopodium opulifolium). Eine Art, die sich mittlerweile unauffällig wohl fast überall in trockenen Ruderalfluren angesiedelt hat, ist das Kurzfrüchtige Weidenröschen (Epilobium brachycarpum), ein Neophyt aus Nordamerika, der Ende der 1990er Jahre erstmals in der Rhein-Neckar-Region festgestellt wurde. Wir fanden die Art unter anderem auf dem Schillerplatz (B3). Ansonsten waren die floristischen Verhältnisse erwartungsgemäß eher unaufregend. Insgesamt zeichnet sich anscheinend auch im Innenstadtbereich das Bild ab, das wir aus der übrigen Landschaft finden: Es gibt einerseits ausbreitungsfreudige und entsprechend weit verbreitete Generalisten und andererseits konservative „Stubenhocker“, die die Ausbreitungswiderstände in der stark fragmentierten Nischen-Landschaft nicht zu überwinden vermögen. Durch die hohen Widerstände in der Innenstadt wird dieses Muster auch auf dieser kleinen räumlichen Skala bemerkbar.
Zur Abrundung des Exkursionstages geht es dann immer noch in ein anderes Gebiet, etwa um die berühmte Adventivflora der Häfen und Umschlagplätze zu untersuchen. Aktuell sind aber besonders die riesigen Baustellen der aufgegebenen Militärquartiere im Norden der Stadt von Interesse. Hier wird viel gewühlt und transportiert, und dabei auch so manche ungewöhnliche Art aufgescheucht und zu unerwarteter Entwicklung verholfen. Die großen Rohbodenflächen sind ideale Ansiedelungs- und Ausbreitungsflächen für so ziemlich alles was kommt – in der Sprache der Populations-Biologie sozusagen „Super Safe Sites“. Bei zurückliegenden Exkursionen (2018) fanden wir z.B. auf der Vogelstang das ungewöhnliche Fallsamengras Sporobolus vaginiflorus, wohl ein Vermächtnis der dort stationierten Amerikaner. 2020 hatten wir uns das ehemalige US-Army-Quartier Benjamin-Franklin-Village bei Käfertal vorgenommen. Dort gibt es neben den Baustellen auch Relikte der Altlandschaft, nämlich lichte Kiefern- und Stieleichen-Haine und Reste der typischen Sandvegetation. Leider behinderte die extreme Trockenheit eine vertiefte Beschäftigung mit der Flora. Viele Solanaceen-Arten, Epilobium brachycarpum, Fuchsschwänze und Gänsefüßler waren aber auch da. Immerhin: Strukturen waren gut zu erkennen. Im Unterwuchs der Haine dominieren recht konsolidierte Schafschwingel-Rasen, wobei der sonst verbreiteten Hart-Schafschwingel (Festuca lemanii) gegenüber dem (vermutlich) am Oberrhein endemischen und seltenen Tomans-Schafschwingel (F. albensis = F. tomanii) stark zurück tritt. Überhaupt scheint hier eine der größten Populationen dieser seltenen Art in Baden-Württemberg zu bestehen, die früher (vor 2015) für F. duvalii oder (noch früher) für F. pallens gehalten wurde (Korneck, D., & Gregor, T. (2015) Festuca tomanii sp. nov., ein Dünen-Schwingel des nördlichen
Oberrhein-, des mittleren Main- und des böhmischen Elbetales (Kochia, 9, 37-58). Nähere Untersuchungen im Frühjahr sind jedenfalls schon gebucht.