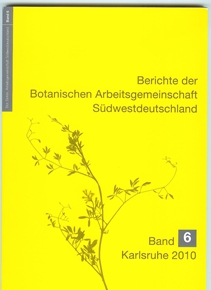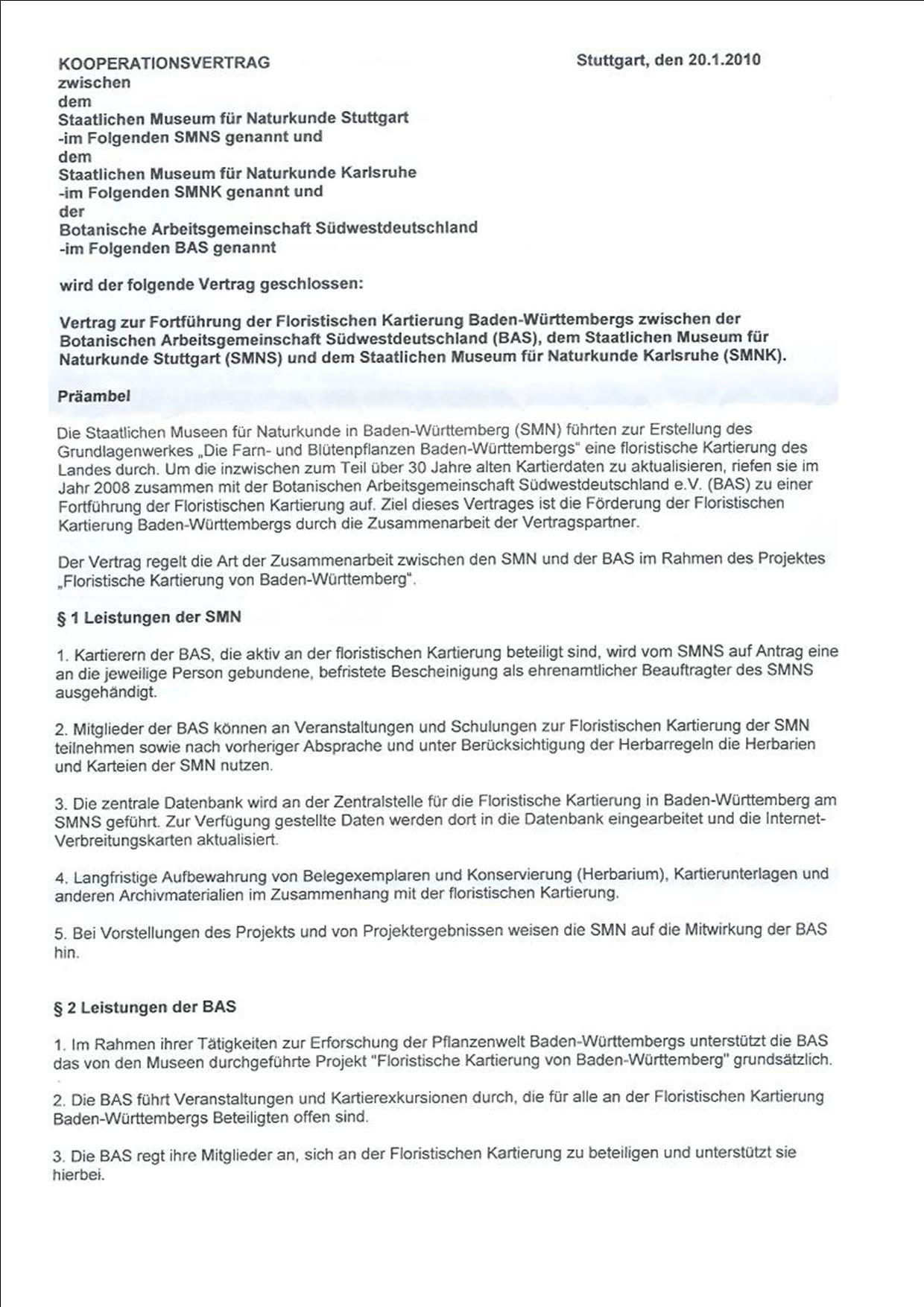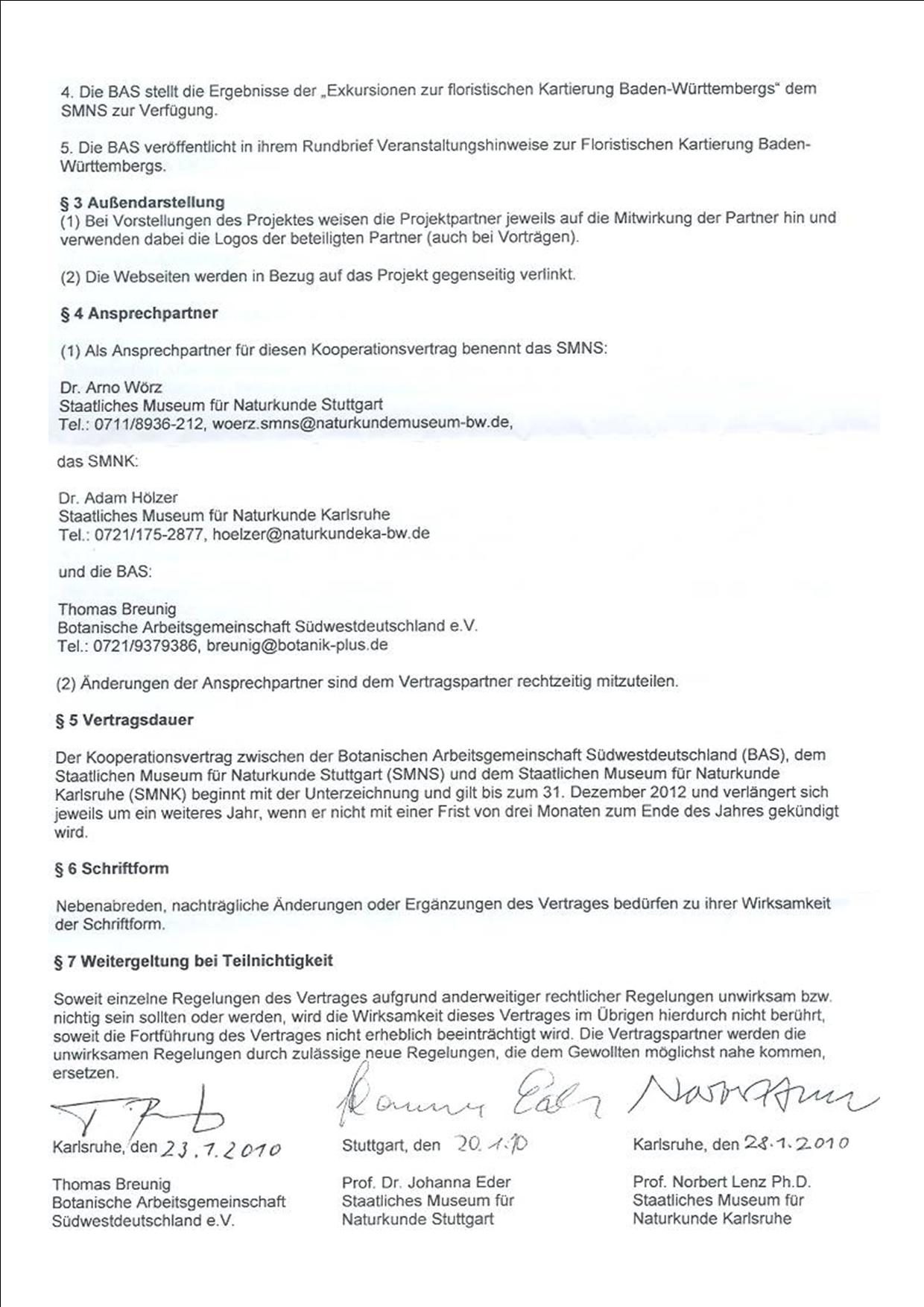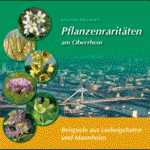Zum Download der Einzelartikel klicken Sie im Inhaltsverzeichnis hinter dem jeweiligen Artikel auf [pdf].
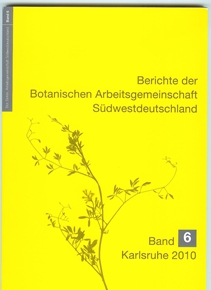
Berichte der botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland Band 6
September 2010
116 S.
Karlsruhe
ISSN 1617-5506
INHALTSVERZEICHNIS
Originalarbeiten
Uwe Amarell: Bemerkenswerte Neophytenfunde aus Baden-Württemberg und Nachbargebieten (2004 – 2008) [pdf]
Wolfgang Schütz, Michaela Adlmüller & Peter Poschlod): Diasporenbank und Vegetation des Eggensteiner Altrheins [pdf]
Gerold Hügin: Panicum dichotomiflorum, P. hillmanii, (P. laevifolium), P. miliaceum subsp. agricola, P. miliaceum subsp. ruderale und Setaria faberi in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten [pdf]
Thomas Breunig: Der Westliche Zürgelbaum (Celtis occidentalis) in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten [pdf]
Sara Altenfelder & Ingo Holz: Wiederfund von Pyramidula tetragona ( Vierkantiges Pyramidenmützenmoos) in Baden-Württemberg [pdf]
Kurzmitteilungen
Gregor Schmitz: Über Verwilderungen der Herzblättrigen Erle (Alnus cordata) in Konstanz [pdf]
Heinz Schultheiss & Thomas Breunig: Ein Neufund des Rankenden Lerchensporns (Ceratocapnos claviculata)in Baden-Württemberg [pdf]
Alfred Buchholz: Das Alpen-Mastkraut (Sagina saginoides) und der Kronenlattich (Calycocorsus stipitatus) auf der baden-württembergischen Adelegg [pdf]
Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (Nr. 668-808), zusammengestellt von Thomas Breunig [pdf]
Jürgen Alberti (Nr. 668 – 671), Thomas Breunig (Nr. 672 – 683), Jens Freigang (Nr. 684 – 685), Steffen Hammel (Nr. 686 – 708), Thomas Junghans (Nr. 709 – 724), Eberhard Koch (Nr. 725), Helmut Märtz (Nr. 726 – 729), Gunter Müller (Nr. 730 – 736), Wolfgang Schütz (Nr. 737 – 738), Hans W. Smettan (Nr. 739 – 753), Franz Stern (Nr. 754), Harald Streitz (Nr. 755 – 770), Martin Weiss (Nr. 771), Stephen Ziegler (Nr. 772 – 808)
Impressum
Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland
Band 6 | September 2010 | Karlsruhe | ISSN 1617-5506
Herausgeberin:
Botanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e.V.
Geschäftsstelle: Bahnhofstr. 38, 76137 Karlsruhe
Telefon: 0721/9379386
Internet: www.botanik-sw.de
E-Mail: info[at]botanik-sw.de
Bankverbindung: Postbank Karlsruhe (BLZ 660 100 75) | Kto. Nr. 607 112-755
Redaktion:
Thomas Breunig | Bahnhofstr. 38 | D-76137 Karlsruhe | info[at]botanik-sw.de
Dr. Gerold Hügin | Kandelstr. 8 | D-79211 Denzlingen | huegin[at]oleco.net
Redaktionsbeirat: Dr. Matthias Ahrens | Dr. K. P. Buttler
Abstracts: Dr. Jonas Müller | Résumés: Dr. Benoît Sittler
Grundlage für die Abbildungen 1 auf S. 24 und S. 88: Topographische Karte 1:25000 –
© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de), vom 01.07.2010, Az.: 2851.2–A/1009.
Manuskripte, die zur Veröffentlichung in den Berichten der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland vorgesehen sind, bitten wir an eines der Redaktionsmitglieder zu senden.
Satz und Layout: Angela Fremmer | Piktom Designbüro, Waldkirch | www.piktom.de
Druck: Hofmann-Druck, Emmendingen | www.hofmann-druck.de
© Botanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e.V.